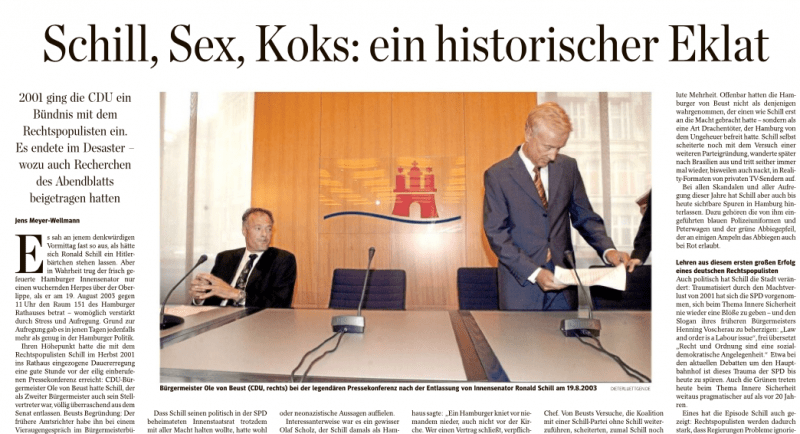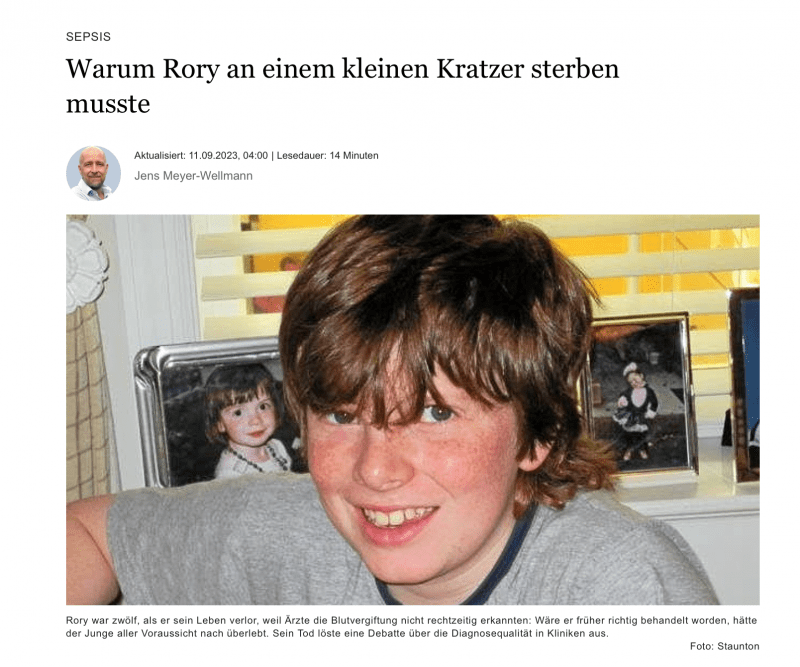Vor 20 Jahren wurde unser Kind tot geboren. Ein Text über Schmerz, Trost und ein mysteriöses Zeichen

Nachdem unsere Tochter tot zur Welt gekommen ist, fahren wir zu McDonald’s. Wir haben sie gewaschen und angezogen, in ein Bastkörbchen gelegt und sie zugedeckt, als könnte sie noch frieren. Wir haben uns in der Klinikkapelle von ihr verabschiedet und dann hat der Bestatter sie geholt.
Und jetzt stehen wir ganz allein in der leeren Kapelle, meine Frau und ich. Es ist schon weit nach Mitternacht, und es gibt nichts mehr zu tun und nichts mehr zu sagen. Also nehmen wir uns an den Händen und gehen zum Parkplatz, steigen in unseren Wagen, schnallen uns an und fahren durch die Dunkelheit.
Es ist nicht vorgesehen, dass man aus einer Geburtsklinik ohne ein Kind nach Hause fährt, denke ich. Ich sehe, wie finster und leer die Straßen der Stadt sind, und ich fühle, wie leer auch wir sind. Vielleicht holen wir deswegen so spät in der Nacht noch so viele Cheeseburger und große Portionen Pommes und Chicken McNuggets aus dem Drive-in und essen sie in unserem Wohnzimmer ohne ein Wort und ohne jeden Skrupel und trinken dazu Bier: um diese Leere zu füllen.
Aber vermutlich haben wir einfach nur Hunger, vor allem meine Frau, denn auch ein totes Kind zu gebären, kostet Kraft. Ein totes Kind hilft nicht mit, es muss von der Mutter ganz allein hinausbefördert werden in eine Welt, die es gar nichts mehr angeht.
All das ist jetzt 20 Jahre her und während ich es aufschreibe, kommt es mir vor wie gestern. Aber je länger ich darüber nachdenke, umso klarer wird mir, dass es doch wirklich sehr weit zurückliegt. Denn es ist so viel geschehen seither mit uns, und so vieles davon hängt mit diesem Abend im Herbst 2003 zusammen.
Die bekannteste Buddha-Legende erzählt vom Verlust eines Kindes
Eine der bekanntesten Legenden des Buddhismus erzählt vom Verlust eines Kindes. Eine junge Frau namens Kisa Gotami hat ihren Sohn verloren und bittet den Buddha, ihn wieder zum Leben zu erwecken. Das werde er tun, verspricht der Erleuchtete, sie müsse ihm dafür nur ein Senfkorn bringen. Und dieses Senfkorn müsse aus einem Haus einer Familie stammen, in dem noch niemand gestorben sei. Kisa Gotami hat kein solches Haus gefunden, und ihr einziges Kind blieb tot. Aber sie verstand den Lauf der Welt und erkannte, dass das Leid in ihr allgegenwärtig und unvermeidbar ist. Niemand wird verschont.
Wir hatten erst im siebten Monat der Schwangerschaft von der schweren Erkrankung unserer Tochter erfahren. Danach setzten wir uns auf unsere kleine Terrasse, wir schwiegen und ich rauchte eine Zigarette, obwohl ich mir das Rauchen längst abgewöhnt hatte.
Der Wind strich sanft durch die beiden Birken vor dem Haus und ich erinnerte mich an das, was ein befreundeter Pastor einmal zu mir gesagt hatte: Gott ist nicht Blitz und Donner. Gott ist das Säuseln zwischen den Blättern.
→ weiterlesen