Der eigene Klimabeirat verpasst Senat aus SPD und Grünen eine Klatsche. Die viel zu spät vorgelegte Zwischenbilanz stecke voller Schwächen, Klimaziele würden so nicht erreicht. Mein Abendblatt-Kommentar.
Ja, das geht: Man kann ein vernichtendes Zeugnis auch in diplomatische Worte verpacken. Genau das hat jetzt der Klimabeirat in seiner Stellungnahme zur Klimabilanz des Senats getan. Die 15 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vermeiden drastische Vokabeln – in der Sache aber ist die zwölfseitige „Empfehlung“ des Gremiums nichts anderes als die sprichwörtliche Ohrfeige für den Senat.
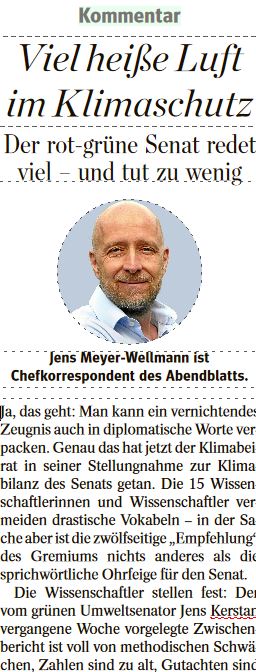
Die Wissenschaftler stellen fest: Der vom grünen Umweltsenator Jens Kerstan vergangene Woche vorgelegte Zwischenbericht ist voll von methodischen Schwächen, Zahlen sind zu alt, Gutachten sind nicht eingearbeitet und der Senat hat es nicht einmal geschafft, seine eigenen 2019 festgelegten Maßnahmen so systematisch auszuwerten, dass man daraus genauere Schlüsse ziehen kann.
Schlimmer noch: Auch wenn SPD und Grüne ihre Klimaziele für 2030 gerade noch einmal auf 70 Prozent CO2-Reduktion gegenüber 1990 verschärft haben, wird Hamburg nach Einschätzung der Experten womöglich nicht einmal das alte Ziel von 55 Prozent erreichen – es sei denn, es wird sofort und massiv beim Klimaschutz nachgeschärft.
→ weiterlesen